
Für Werner ist Künstliche Intelligenz sowohl ein Werkzeug als auch ein strategischer Partner, der uns hilft, die Qualität und Effizienz der medizinischen Versorgung zu steigern. (Foto von Cash Macanaya auf Unsplash)
„Wir betrachten KI als einen zentralen Weg, die Medizin menschlicher zu machen.“
Ist KI nicht schon längst in Forschung und Entwicklung angekommen?
Aber selbstverständlich, auch wenn dies noch nicht in vollem Umfang wahrgenommen wird. Künstliche Intelligenz ist bereits heute ein integraler Bestandteil von Forschung und Entwicklung geworden, insbesondere in der modernen Medizin. Durch KI können wir riesige Datenmengen analysieren, Muster erkennen und personalisierte Therapien entwickeln, die auf den individuellen Bedürfnissen der Patienten basieren. Künstliche Intelligenz ist sowohl ein Werkzeug als auch ein strategischer Partner, der uns hilft, die Qualität und Effizienz der medizinischen Versorgung zu steigern.
An der Universitätsmedizin Essen haben wir bereits 2020 das Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin (IKIM) gegründet und das damals als eines der ersten in Deutschland in diesem wichtigen Innovationsfeld. Wir arbeiten hier nicht im Elfenbeinturm, sondern in höchstem Maße praxis- und lösungsorientiert im engen Schulterschluss mit den medizinischen Disziplinen bei uns in der Klinik.
Das IKIM ist zudem Teil der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen und somit auch in ein wissenschaftliches Umfeld eingebunden. Es ist ein Leuchtturm und zentraler Baustein für die Zukunft der Medizin, weil es Diagnostik, Prävention und Therapie durch die Verbindung zwischen digitalisierten Daten und medizinischer Expertise nachhaltig verbessern kann. Wir betrachten KI als einen zentralen Weg, die Medizin menschlicher zu machen.
Warum muss über KI immer noch so sehr diskutiert werden?
Diese Frage stellt sich in dieser grundsätzlichen Diktion immer noch überwiegend in Deutschland und der EU, kaum in anderen Teilen der Welt. Ich möchte daher sagen: Weil der Einsatz von KI nicht nur eine technologische, sondern auch und gerade eine gesellschaftliche und ethische Herausforderung darstellt. Dieses Spannungsfeld ist sicherlich wichtig. Ich würde mir aber wünschen, dass – wie bei allen Zukunftstechnologien – prioritär die Chancen und nicht nur die Risiken gesehen werden.
Natürlich wirft KI auch eine Reihe von Fragen auf, zum Beispiel nach der Rolle von Medizinern, der Interaktion mit Algorithmen, der Entscheidungsfindung und Entscheidungsverantwortung, natürlich auch dem Datenschutz. Viele befürchten den Verlust der Menschlichkeit und ihrer persönlichen Daten – ich hingegen befürchte eher, dass wir unserem Auftrag, Patienten optimal zu versorgen, durch eine Verweigerungshaltung nicht gerecht werden.
Aber natürlich braucht es eine transparente Aufklärung, um zu zeigen, wie Digitalisierung und KI am Ende dafür sorgen, dass die Medizin wieder empathischer wird und den Menschen konkret zugutekommt. Im weiteren Verlauf wäre sicher dann auch eine zeitgemäße Anpassung des Datenschutzes nötig, der leider noch den Geist der Ursprungsphase atmet. Insgesamt müssen wir dafür sorgen, dass die Akzeptanz für KI erhöht wird, um ihre Chancen besser und konsequenter zu nutzen.
Noch anders gefragt: Sollten wir weniger über KI diskutieren und lieber mehr mit KI versuchen?
Vorbehaltlos ja, weil erst durch die Erfahrung natürlich auch ein Erkenntnisgewinn gelingt. Eine offene Diskussion über Digitalisierung und KI ist wichtig, um Akzeptanz zu schaffen, Fragen zu klären und das Vertrauen der Menschen in die Technologie zu fördern. Dennoch dürfen wir uns nicht in dem ewigen Bedenkenträgertum verlieren - wir müssen auch, banal gesagt, einfach mal anfangen, mal machen.
Genau so sind wir übrigens auch vorgegangen, als wir uns in Essen 2015 auf den Weg zum Smart Hospital begeben haben. Wir sind ohne strikte Zielvorgaben gestartet, um während des Transformationsprozessen flexibel auf Veränderungen reagieren und aus Erfahrungen lernen zu können. Wir wussten zu Beginn nicht, wo der Prozess endet. Wir wussten nur, dass er unbedingt notwendig ist. Ein wichtiges Erfolgsgeheimnis war es, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Prozesse einzubinden, Optimierungspotenziale in den einzelnen Bereichen zu identifizieren und passgenaue Lösungen zu finden. So wünsche ich mir das auch bei Künstlicher Intelligenz, sowohl auf der Mikroebene Klinik als auch auf der Makroebene Gesundheitssystem und -versorgung.
Über welches Potenzial verfügt KI in der Pharmaindustrie?
Als Vorstandvorsitzender und Ärztlicher Direktor einer Universitätsmedizin beschäftige ich mich hauptsächlich mit dem Potenzial von KI für Kliniken und das Krankenhauswesen. Aber ich denke, hier wird es einige Parallelen geben. KI und Digitalisierung sind der Schlüssel für das Krankenhaus der Zukunft, das den Menschen konsequent in den Mittelpunkt des Handelns stellt. Ein solches „Human Hospital“ muss auch „smart“ sein, also mithilfe von KI und durch Digitalisierung Prozesse effizienter gestalten und die medizinische Versorgung verbessern.
Dass Künstliche Intelligenz die Diagnostik und individualisierte Therapien verbessern wird, daran ist nicht zu zweifeln. Und daher werden sicherlich auch die unverzichtbaren Produkte der Pharmaindustrie zunehmend mithilfe von KI erforscht, entwickelt und produziert.
Ich möchte aber noch einen weiteren Gedanken erläutern. Das Krankenhaus der Zukunft muss auch „green“ sein. Als Mediziner ist es unsere Aufgabe, Menschen bei der Gesundung zu unterstützen. Dies ist sicherlich auch das Selbstverständnis der Pharmaindustrie. Dies funktioniert jedoch nur in einer gesunden Umwelt. Gerade wir im Ruhrgebiet als eines der größten industriellen Ballungsräume Europas wissen seit dem 1961 von Willy Brandt ausgerufenen „blauen Himmel über der Ruhr“ um die Wechselwirkungen von Krankheit und intakter Natur.
Daher müssen sich Krankenhäuser nicht nur ihrer ökologischen Verantwortung bewusst werden – diese nichtssagende Banalität kann ich persönlich nicht mehr hören – sondern im Sinne des Umwelt- und Klimaschutzes konkret agieren. Auch dies tun wir mit einer Fülle von konkreten, messbaren Maßnahmen. Und schließlich muss das Krankenhaus der Zukunft „economic“ werden, also im wirtschaftlichen Interesse handeln. Das ist essenziell, um die Gesundheitsversorgung langfristig finanzierbar zu machen.
Und wie wird KI den Diagnostik-Bereich beeinflussen?
KI unterstützt dabei, Diagnosen schneller und präziser zu machen. Durch die Analyse von Big Data kann KI Muster erkennen, die von Menschen oft übersehen werden, und so zu einer besseren Früherkennung und Therapieplanung beitragen. Die KI kann die Diagnostik personalisieren, indem sie auf genetische, klinische und Life-Style-Daten zurückgreift und so die optimale individuelle Behandlungsoption gefunden werden kann.
An der Universitätsmedizin Essen sehen wir bereits, wie KI in der radiologischen Bildgebung, Pathologie und Analyse von Patientendaten eingesetzt wird. Sie unterstützt bei der Entscheidungsfindung, aber entlastet zugleich von Routineaufgaben, sodass mehr Zeit für die individuelle Betreuung von Patientinnen und Patienten bleibt.
Können Sie konkrete Beispiele nennen, die für Sie augenöffnend gewesen sind?
Vor allem der Einsatz von KI in der radiologischen Diagnostik hat mich sehr beeindruckt, hier sind wir auch schon wirklich weit. KI-gestützte Systeme erkennen bei der Analyse von Röntgenbildern und CT-Scans Muster, die für das menschliche Auge schwer oder nicht sichtbar sind. Aber auch die Leistung unseres Instituts für Künstliche Intelligenz in der Medizin, des IKIMs, insbesondere das Entwickeln individueller Therapieansätze durch das Analysieren großer Datenmengen, war ein großer Fortschritt.
Ich bin davon überzeugt, dass die KI in Verbindung mit einer funktionierenden digitalen Infrastruktur großartige Wirkungen bei der Prozessoptimierung spielen kann, insbesondere der Entlastung des medizinischen und Pflegepersonals von sich wiederholenden und administrativen Tätigkeiten.
Diese eher systemischen Effekte von KI in der Klinik, aber auch in der Interaktion aller medizinischen Dienstleiter werden nach meiner Meinung noch völlig unterschätzt. Gerade angesichts der sich dramatisch verschärfenden Situation bei Krankenversicherung und Pflegekassen kann KI zwar nicht allein das Gesundheitssystem retten – dazu sind schmerzhafte Strukturreformen unverzichtbar –, aber doch einen maßgeblichen Beitrag bei Effizienzsteigerung und damit Kostenminimierung leisten.
Wie muss oder kann KI in Zukunft eingesetzt werden, dass die Technologie wirkliche Synergien schaffen kann – also auch über eigene Unternehmens- und Wissenschaftsgrenzen hinweg?
KI entfaltet ihr volles Potenzial nur dann, wenn wir sie als gemeinsames Werkzeug begreifen, das nicht an den Grenzen von Unternehmen, Universitäten oder Ländern Halt macht. Wir müssen verstärkt auf Kooperationen setzen – zwischen Wissenschaft, Industrie und auch staatlichen Institutionen. Der Schlüssel liegt in einer offenen Daten- und Wissensplattform, die den sicheren Austausch ermöglicht und gleichzeitig die Interessen aller Beteiligten wahrt.
Gerade in der Medizin zeigt sich, wie wichtig es ist, KI nicht isoliert zu entwickeln. Durch den Austausch von Daten und Algorithmen über Institutionen hinweg können wir Synergien schaffen, die letztlich den Patientinnen und Patienten zugutekommen. Auch eine solche Vernetzung und Verbesserung der Prozesse und Systeme treibt beispielsweise das Essener IKIM voran.
Was denken Sie: Wo werden wir mit und durch KI in Pharma in ein paar Jahren sein?
Prinzipiell bin ich davon überzeugt, etwa vor dem Hintergrund des Handlings und der Auswertung klinischer Studien, dass KI und die Verarbeitung großer Datenmengen gerade für die Pharmaindustrie großen und messbaren Nutzen stiftet.
Und wenn wir den Blick über die Medizin hinaus richten, was wir als Mediziner leider zu selten tun, sehen wir doch den großen Nutzen von ChatGTP bis hin zu Bereichen wie Mobilität und Kommunikation. Ich persönlich freue mich sehr, die unglaubliche Dynamik von KI weiterhin zu verfolgen und konkret zu nutzen. Und schließlich wird sowohl die Entwicklung neuer Medikamente als auch die Optimierung aktueller Studienkonzeptionen durch KI deutliche Schritte nach vorne machen.
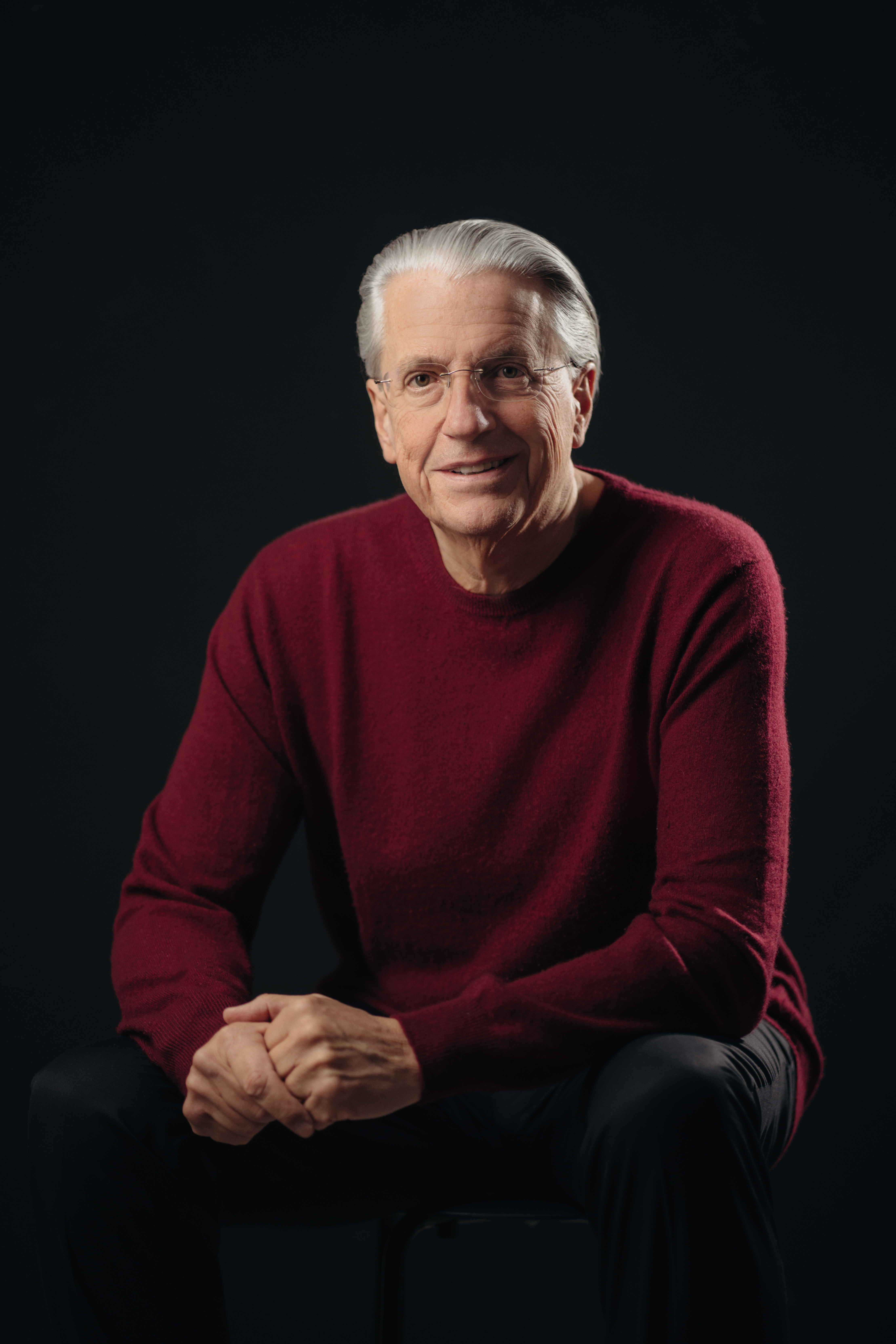
Prof. Jochen Werner
Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Universitätsmedizin Essen sowie Co-Founder 10xD
Die Fragen in der Übersicht:
- Ist KI nicht schon längst in Forschung und Entwicklung angekommen?
- Warum muss über KI immer noch so sehr diskutiert werden?
- Noch anders gefragt: Sollten wir weniger über KI diskutieren und lieber mehr mit KI versuchen und dann darüber aufklären?
- Über welches Potenzial verfügt KI in der Pharmaindustrie?
- Und wie wird KI den Diagnostics-Bereich beeinflussen?
- Können Sie konkrete Beispiele nennen, die für Sie augenöffnend gewesen sind?
- Wie muss oder kann KI in Zukunft eingesetzt werden, dass die Technologie wirkliche Synergien schaffen kann —also auch über eigene Unternehmens- und Wissenschaftsgrenzen hinweg?
- Was denken Sie: Wo werden wir mit und durch KI in Pharma in ein paar Jahren sein?
Erhalten Sie jetzt uneingeschränkten Zugriff auf alle interessanten Artikel.
- Online-Zugriff auf das PM-Report Heftarchiv
- Aktuelle News zu Gesundheitspolitik, Pharmamarketing und alle relevanten Themen
- 11 Ausgaben des PM-Report pro Jahr inkl. Specials

